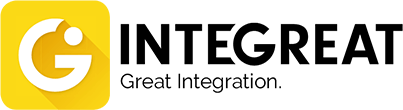Studie untersucht Nutzung der digitalen Integrationsplattform Integreat in Deutschland
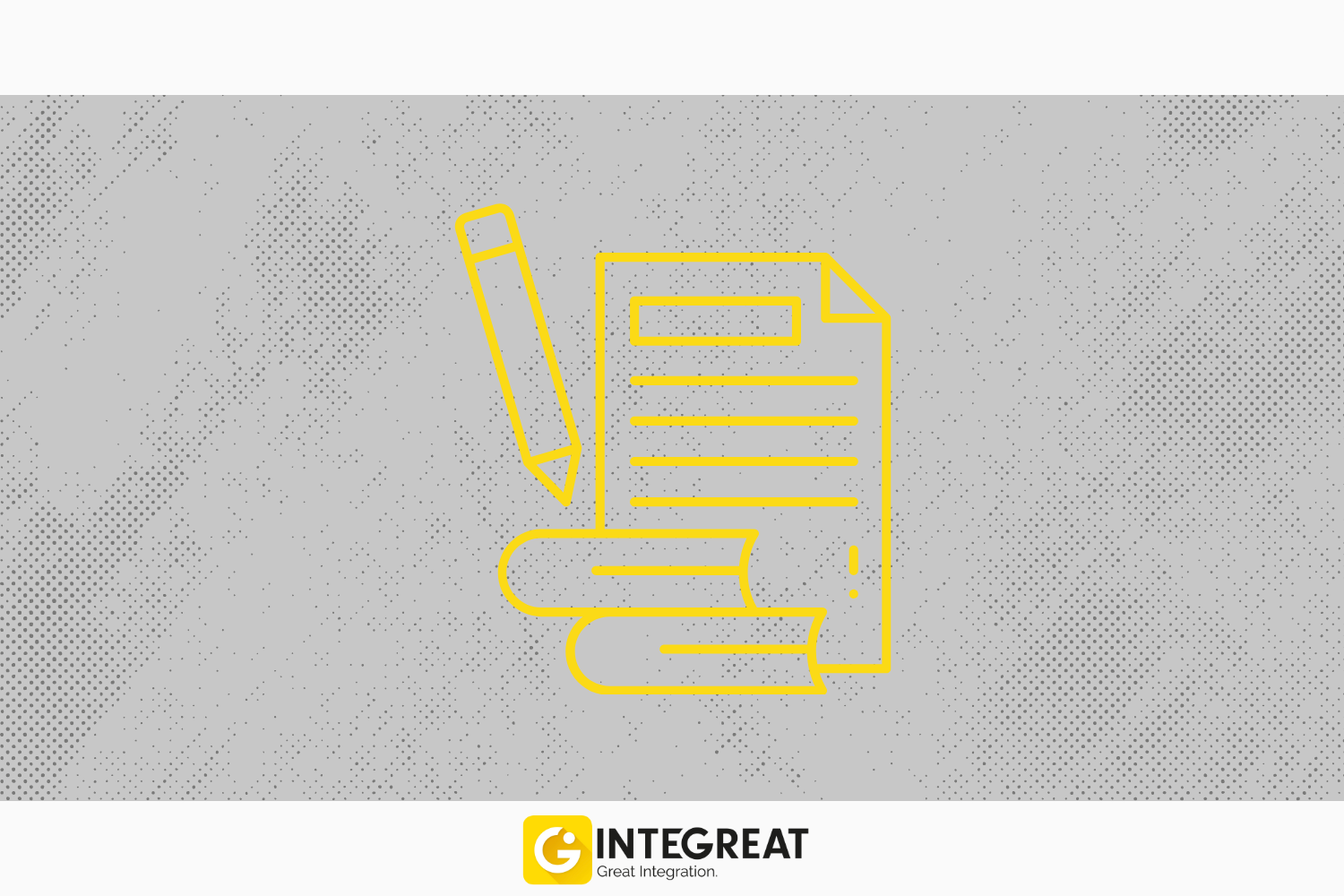
Die Forschungsarbeit „Information on Integration: Administrative Offerings & Immigrant Engagement – Eine explorative Large-N-Analyse der Integreat-Plattform in Deutschland“ von Samir Khalil (2025) untersucht, wie über 100 deutsche Städte und Landkreise die digitale Integrationsplattform Integreat einsetzen. Grundlage der Analyse sind mehr als 11 Millionen Seitenaufrufe aus den Jahren 2018 bis 2024. Ziel ist es, zu verstehen, welche Themen lokale Verwaltungen priorisieren, wie diese von Nutzer:innen angenommen werden und wie sich Informationsbedarfe zwischen Sprachgruppen unterscheiden.
Kernaussage
Digitale Integrationsplattformen entfalten ihr Potenzial dann am besten, wenn sie mehrsprachige, lokalpraktische und bedarfsorientierte Informationen bereitstellen. Besonders wichtig sind Themen zu Wohnen, Sprache, Recht und Alltag, welche direkt an den Lebensrealitäten der Zielgruppen ansetzen. Eine kontinuierliche Pflege und datengestützte Priorisierung sichern die langfristige Wirkung und Akzeptanz der Plattform.
In Bezug auf Krisenreaktionen zeigt die Studie, dass Regionen, die zum Zeitpunkt des Beginns des Ukrainekriegs bereits online waren, sehr schnell reagieren konnten. Innerhalb weniger Wochen erweiterten sie ihre Plattform um Ukrainisch und/oder Russisch. Drei Monate nach Kriegsbeginn hatten 70 % Ukrainisch im Angebot – vorher keine einzige Kommune. In dieser Zeit stiegen auch die Zugriffszahlen deutlich an.
Thematische Schwerpunkte
Die meisten Kommunen konzentrieren sich auf klassische Integrationsthemen:
- Arbeit & Ausbildung
- Deutsch lernen
- Familie & Kinder
- Beratung & Hilfe
Seltener abgedeckt sind Themen mit hohem Alltagsbezug wie Mobilität, Öffnungszeiten & Feiertage, Wohnen, Rassismus & Diskriminierung oder Informationen für ältere Menschen. Diese Unterschiede deuten auf unterschiedliche Prioritätensetzungen hin – bedingt durch lokale Ressourcen, Verwaltungsstrukturen oder Annahmen über Zielgruppenbedarfe.
Nutzung und Engagement
Das Nutzungsverhalten entspricht nicht immer den thematischen Schwerpunkten der Verwaltungen.
- Am häufigsten aufgerufen werden praktische, alltagsnahe Themen wie Öffnungszeiten, Mobilität oder Behördenkontakte, die jedoch oft kaum vorhanden sind.
- Hohe und nachhaltige Nutzung zeigen Inhalte zu Wohnen, Deutsch lernen, rechtlichen Fragen und Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine.
- Mehr Inhalte führen zu mehr Nutzung, insbesondere bei den zentralen Themen Sprache, Rechtsstatus und Wohnen. Einen Sättigungseffekt gibt es nicht.
- Themen wie LGBTQ-Informationen oder Freizeitangebote erzielen höhere Zugriffsraten, als ihre geringe Präsenz erwarten lässt.
Unterschiede nach Sprache
Das Informationsinteresse unterscheidet sich deutlich zwischen den Sprachgruppen:
- Ukrainisch/Russisch: hohe Nachfrage zu Wohnen und Sprachkursen
- Arabisch: starkes Interesse an rechtlichen Informationen
- Farsi/Dari: überdurchschnittliche Nutzung von LGBTQ-Inhalten
- Englisch: häufige Nutzung für Mobilität und Verwaltungsthemen, weniger für Arbeit & Ausbildung
Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Sprachgruppen: Relevante Themen variieren je nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.
Implikationen für Städte und Landkreise
1. Praktische Themen stärken:
Alltagsrelevante Informationen (Öffnungszeiten, Mobilität, Wohnen) werden stark nachgefragt, sind aber häufig unterrepräsentiert.
2. Sprachversionen strategisch planen:
Übersetzungen sollten sich am tatsächlichen Bedarf orientieren. Arabisch und Ukrainisch bleiben zentrale Sprachen, ergänzt durch Englisch als Brückensprache.
3. Nutzungsdaten aktiv auswerten:
Klickstatistiken können Hinweise liefern, welche Themen und Sprachen in der eigenen oder in anderen Regionen am wichtigsten sind.
4. Ressourcen langfristig sichern:
Die meisten Kommunen investieren weniger als vier Stunden pro Woche in die Pflege. Eine moderate Erhöhung dieser Zeit kann den Nutzen deutlich steigern.
5. Kooperation fördern:
Der Austausch mit Nachbarregionen oder Partnerkommunen kann helfen, Inhalte und Übersetzungen effizienter zu teilen und zu aktualisieren.
Fazit
Die Studie von Samir Khalil zeigt, dass die digitale Integrationsplattform Integreat ihr Potenzial besonders dann entfaltet, wenn sie mehrsprachig, alltagsnah und kontinuierlich gepflegt ist. Die Analyse liefert Kommunen wertvolle Hinweise, wie sie ihre Informationsangebote strategisch weiterentwickeln können.
Weiterführende Informationen
📄 Samir Khalil (2025): Information on Integration: Administrative Offerings & Immigrant Engagement – Eine explorative Large-N-Analyse der Integreat-Plattform in Deutschland.
🔗 Zur Studie auf journalqd.org
📱 Mehr zur Integreat-App: www.integreat-app.de